Die meisten Menschen, die ein Musikinstrument spielen, tun dies in der Freizeit zu ihrem Vergnügen, deshalb nennt man sie Amateure. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) verwendet noch das deutsche Wort: Liebhaber. Das Gegenstück zum Liebhaber sind für ihn die „Kenner“, die ausgebildeten Musiker. C.P.E. Bachs „Sechs Sammlungen mit Klaviermusik“ aus seinen letzten Lebensjahren waren „für Kenner und Liebhaber“ gleichermaßen bestimmt. Der Komponist achtet auf die Balance zwischen ihnen: in den sechs Sonaten der ersten Sammlung sind die technisch aufwändigen Nummern (2,4 und 6) für die Kenner, die ungeraden Nummern für die Liebhaber. Interessanterweise richtet sich die fünfte Sonate in F-Dur nicht an die Kenner, sondern an die Liebhaber. Sie ist die das unkonventionellste Werk der ganzen Sammlung. Am Anfang findet sie erst nach langen Umwegen zu einer Grundtonart, erst im Nachhinein erkennen wir das tonale Koordinatensystem. Wir empfinden diese Musik heute noch als experimentell. Den Liebhabern mutet Carl Phillip Emanuel Bach also einiges zu. Er weigert sich, ihren Verstand und ihre Musikalität geringzuschätzen, auch wenn er auf pianistische Schwierigkeiten bewusst verzichtet.
Als Klavierlehrer pflichte ich ihm bei. Amateure mögen zwar spieltechnisch an ihre Grenzen stoßen, und manchmal haben sie Vorurteile (das haben sie mit den Berufsmusiker gemein), doch dies ist kein Grund, sie intellektuell oder künstlerisch zu unterfordern. Sie stecken in einem Lernprozess und haben die Chance, aber auch die Pflicht, ihre Ansichten zu revidieren und Neues auszuprobieren – und sei es nur ein ungewohnter Fingersatz.
Spielt man selbst ein Instrument, macht man die irritierende Erfahrung, dass die banalsten instrumentaltechnischen Probleme und die tiefsten musikalischen Erkenntnisse oft nahe beieinander liegen. Nirgends macht sich der Wert oder Unwert einer Komposition so deutlich bemerkbar wie im Unterricht. Gerade bei Anfängern, wo Schüler und Lehrer jede richtige Note mühsam erkämpfen, ist es von existenzieller Bedeutung, dass auch jede dieser Noten einen Sinn ergibt, sonst verzweifeln alle Beteiligten. Eine wirklich gute Komposition jedoch, seien es Beethovens Bagatellen, Erik Saties Kinderstücke oder Ruth Crawford-Seegers Sammlungen amerikanischer Folksongs, kann auch für den Lehrer zu einem Kunsterlebnis werden – gerade wenn sie Takt für Takt einstudiert werden muss.
Im ausgehenden 18. Jahrhundert waren die Liebhaber die ökonomische Basis des neu entstandenen bürgerlichen Musiklebens, denn dieses finanzierte sich vorwiegend aus dem Verkauf von Noten. Doch die damaligen Amateure waren nicht nur die Sponsoren der Komponisten, sondern auch deren Ansprechpartner. Jede Kunst, und sei sie noch so autonom, braucht ein Gegenüber. Das hört man auch in den Kompositionen: Als sich die Musik von den Zwängen der feudalistischen Gesellschaft löste und sich dem Bürgertum zuwandte, wurde sie beweglich, sie wechselte Tonart und Affekt innerhalb eines einzelnen Satzes. Dies manifestierte sich zuerst in der Klaviermusik –die ersten, die davon Kenntnis nahmen, waren klavierspielende Laien.
Heute ist das Kulturangebot riesig, doch das ästhetische Selbstverständnis des Bürgertums als tragende Schicht ist brüchig geworden. Der Besuch von Konzerten und Opernaufführungen ist keine gesellschaftliche Pflicht mehr, und das Interesse an aktuell komponierter Musik überlässt man den Spezialisten für die Moderne. Längst haben Tonträger das Selberspielen ersetzt.
Man muss dem Bildungsbürgertum nicht nachtrauern. Es waren nicht zuletzt die Künstler selbst, die gegen die zunehmend erstarrten Kriterien und den Klassendünkel revoltierten. Was dagegen fehlt, ist ein neuer Ansprechpartner für die Musiker. Wer führt die Diskussion darüber, was relevant und was belanglos ist, was schön und was Kitsch? Heute entscheiden das entweder Expertengremien oder Einschaltquoten, beides scheint mir fragwürdig. Im einen Fall wird die Hörerfahrung an Fachleute delegiert, im anderen Fall werden Quote und Klickzahlen so unkritisch wie ein Gottesurteil akzeptiert.
Was müsste geschehen, damit die Liebhaber wieder vermehrt am Musikleben teilhaben? An Versuchen, Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Amateure in Konzertreihen miteinzubeziehen mangelt es nicht. Projekte wie „Rhythm is it!“, eine Choreographie von Stravinskys „Sacre du Printemps“ mit Berliner Schülern und den Berliner Phillharmonikern, sind vom Wunsch getrieben, ein jüngeres Publikum in die Konzertsäle zu locken. Doch diesen Aktionen fehlt die Selbstverständlichkeit, mit der die Komponisten des 18. Jahrhunderts die Liebhaber als gleichberechtigte Partner in ihr Schaffen miteinbezogen.
Könnte da auch eine Angst der Musiker vor einem Statusverlust mitspielen? Der „Kenner“ von C.P.E.Bach ist zum „Profi“ geworden. Bach hatte es, als schlecht bezahltem Cembalisten am Hof Friedrich des Großen, fern gelegen, seine Bedeutung als Musiker an Geld zu koppeln. Heute jedoch hängt die materielle Existenz eines Berufsmusikers davon ab, dass er sein instrumentales Können von vom bloßen Dilettanten abgrenzen kann: Zu viel Nähe zu Laienmusikern könnte seinem Ruf schaden.
Doch als Musiker muss man es aushalten, dass die eigene Position im Musikleben gelegentlich hinterfragt wird. Musik ist ein permanenter Prozess der Veränderung. Wo sind die Gemeinsamkeiten zwischen den Kennern und den Liebhabern? Was kann jeder Spieler nach seinen Fähigkeiten realisieren? Die Freude am Experiment beispielsweise oder der Mut zum Risiko sind Tugenden, die man auf jeder spieltechnischen Stufe ausleben kann.
Gerade weil sich das Unterrichtsverhältnis über Jahre erstreckt, kann man es als Lehrer erleben, dass Leute plötzlich „dahin kommen, wo sie niemals geglaubt haben“ (C.P.E.Bach) und sei es nur, dass ein musikbegeisterter Schüler im Seniorenalter mir erklärt, dass er nun auch bei Schönberg die falschen Noten höre.


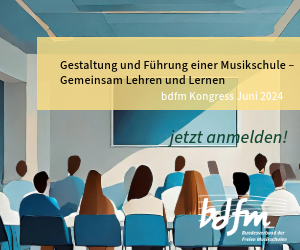

Dieser Beitrag hat 0 Kommentare